Anbieter zum Thema
Welche Hürden und Chancen sehen Sie bei der gemeinsamen Ausgestaltung der Verwaltungsschale?
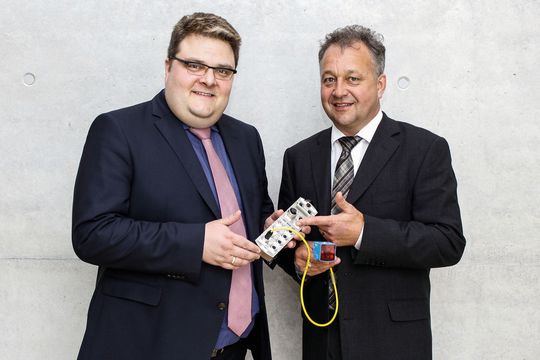
Jörg Krautter: Im Zuge des Megatrends Industrie 4.0 werden im Laufe der nächsten Jahre Schritt für Schritt alle Automatisierungskomponenten – die sogenannten Smart Products – einer Maschine bzw. Anlage von der Produktionsebene (Shop Floor) mit der Büroebene (Office Floor) vernetzt. Das Smart Product bildet damit den Schlüssel der Vernetzung. In der Verwaltungsschale werden alle Gerätekriterien beschrieben. Eine Herausforderung ist die Semantik und Ontologie der Komponenten. Denn die Komponenten müssen alle die gleiche Sprache sprechen. Auch die Inhalte der Verwaltungsschale müssen noch definiert werden. Mit dem Leitfaden haben wir jetzt einen ersten Schritt gemacht. Als weiteres großes Thema sehen wir den Schutz des Eigentums: Wem gehören die Daten? Die Rechtslage muss hierfür noch geklärt werden. Also: Welche Daten veröffentlicht werden und wie sich die Datentransparenz für den Wettbewerb gestaltet.

Armin Pühringer: Generell ist der Einsatz einer Industrie-4.0-Komponente, die hinsichtlich Funktionalität und Schnittstelle durch die Verwaltungsschale beschrieben wird, noch in der Erprobung und damit entfernt von einer konkreten Ausprägung und dem operativen Einsatz. Die Balance zwischen einer Generalisierung von gleichen Produkten in einem generischen Ansatz und der notwendigen Differenzierung im Wettbewerb untereinander ist hier sicherlich auch noch für die betroffenen Produktgruppen zu finden. Die großen Chancen liegen in der Virtualisierung der realen Objekte – übrigens sowohl in der Produktionstechnik als auch bei den Kundenprodukten – und der so erzielten tiefen Integration in die IT-Anwendungen hinein und den daraus entstehenden neuen Geschäftsmodellen und Geschäftsmöglichkeiten.

Dr. Jan Stefan Michels: Die aktuellen Informationsmodelle enthalten schon weitaus mehr als nur Bestell- oder Materialdaten. Das langfristige Ziel ist, einen virtuellen Produktzwilling zu erschaffen, den alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette nutzen können, sei es der Maschinenbauer, der Betreiber, der Großhändler als auch wir als Hersteller. Durchgängig verfügbare Datenmodelle sind ein Grundpfeiler der digitalen Produktion. Hierfür sind standardisierte Schnittstellen zwischen virtuellen Produktdaten und den miteinander vernetzten Engineering-Tools und Product-Lifecycle-Management-Systemen (PLM) notwendig. Aufgrund dieser Datensätze können neuartige Geschäftsmodelle entstehen, z.B. kann die Analyse der Anwendungen eines Reihenklemmen-Kunden dafür genutzt werden, um ihn mit Informationen über neue Produkte und Lösungen zu informieren, die seine Applikation beispielsweise effektiver und platzsparender löst. Eine entsprechende Information wird einfach beim nächsten Bestellvorgang maßgeschneidert eingespielt. Für die Digitalisierung müssen alle Seiten an einem Strang ziehen – Kunde und Hersteller. Deshalb gilt es auch, Verbände und Gremien zu sensibilisieren, um, wo es erforderlich ist, das Thema in einen entsprechenden Standard zu überführen.
(ID:44589936)






:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3d/fe/3dfef65797a84446c2ec39366eb6156c/0128875162v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/72/17/72172d29682fe0bc0f58a58e285a145e/0129415057v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/36/31/3631b44ccca0c7e184fc9c59c5942889/0128962862v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bb/b2/bbb2ebbb77d424786a78044025581c3d/0129100353v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/87/bf/87bfcfd29a2e259c300950f6b3636b4b/0129467133v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/44/f944989459fbf8b3dfbd10c06319d0ed/kaizenics2-1536x863v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b9/39/b9393dade70a5a6a36326eac392100d1/0129309218v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8f/ac/8facc0a081d779264af3f7a6b7b3b925/0129493475v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5a/fe/5afe3f4762e8cb41ddaa0346840b7594/0128612915v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/64/e5/64e5f738d7850df7a8b743999354a38c/greenspeed-visual-home-1500x843v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/54/a3/54a31cb0eab811647e5ef6a59ff95ec0/0129146947v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/57/d7571dfa93accb43ff8b4faa17ce8625/01-sieb-meyer-gmn-vergleichstest-rgb-2126x1196v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/68/93/689318da40a0a462b40f3423ac56455c/01-sieb-meyer-gmn-vergleichstest-rgb-2126x1196v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ae/b5/aeb598fc8ddadbf47b3ab6373fd788b9/0129501004v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/a2/a7a25a5b2f973de0a53aec59ea1ae1a6/0129492013v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/5c/1d5c96c0cc70051885a54323210d43b7/roboter-20hand1-1240x698v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7c/2f/7c2f4e648a12da928ea9fb9bdba19ae7/newsimage417872-5877x3304v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2e/a4/2ea42cf96f3e6f7bf9d18e94f41e8949/tum-4000x2248v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/52/7a/527ad5ae7d10b9e34b72570639d7870c/plagiarius-zwerg-gnome-2849x1602v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ff/a3/ffa3432394e98b10ea5b5e4292e6f8b5/0129327215v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4f/0f/4f0fb6d0036a7e5b78f6c13b2cc8544b/0129468837v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e1/ad/e1ad97c78305431215cab0ae08ddfc1e/laj987-digital-grading-10006743-1280-1280x720v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/8b/ec8b9c991b5c25fdc483a9c4f062c01f/adobestock-340905887--c2-a9-20gorodenkoff-20-e2-80-93-20stock-adobe-com-5120x2877v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/00/9e/009e804cf94753acdf1bc7e06e69e6ba/0128607882v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/58/63/586379bda19d8f06e6015cecb41a4967/kampagnenbild-1947x1095v1.png)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/12/d112dfa6e7df4c7af715a4833483f659/0126977441v1.jpeg)
:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1651700/1651739/original.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/113800/113818/65.jpg)
:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/76800/76895/65.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/a4/68a47beec75ce/logo-cmyk-de.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/08/80/08804f894c8fb15604c9f2c494ff3ce7/0120952935v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/26/48/2648167f2a560527a34500f8d58b5c88/0124487900v2.jpeg)